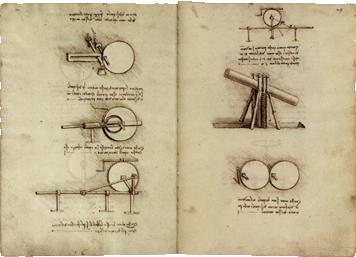Edition und Struktur des Codex Madrid I*
1. Die Wiederauffindung der Handschrift 2. Retis Facsimile-Edition von 1974 3. Struktur der Handschrift: Praktischer und theoretischer Teil 4. Von Venturi zu Mario Taddei: Ältere und neuere Studien zur Mechanik Leonardos |
1. Die Wiederauffindung der Handschrift
Die Überlieferung war dem Nachlass Leonardos bekanntlich nicht günstig. Eine große Zahl von Handschriften aus seinem Nachlass gelangte 1519 zwar testamentarisch in die Hände eines treuen Schülers, des Mailänders Francesco Melzi, doch begann spätestens nach dessen Tod um 1570 die tragische Zerstreuung
. Sie führte dazu, dass heute die wertvollsten Manuskripte in Mailand, Turin, Venedig, London, Windsor Castle, Paris und Madrid zu suchen sind und dass nach wie vor eine nicht näher zu präzisierende Menge von Bänden verschollen ist1. Die heutigen Bände Madrid I-II sind am ehesten durch Pompeo Leoni, den Hofbildhauer König Philipps II., von Mailand nach Spanien gelangt. Aus dem Besitz des Juan de Espina gelangten sie nach dessen Tod 1642 in den königlichen Palast und aus diesem in die königliche Bibliothek. Heutige Signatur: Biblioteca nacional de España mss. 8936-8937. Codex Madrid I ist die Nummer 89372.
Die Umstände, seit wann und warum diese Bände nach ihrer Katalogisierung 1830 bis zum Jahre 1965 nicht mehr auffindbar waren, sind nicht völlig geklärt, die Umstände ihrer Wiederauffindung auch nicht. Der amerikanische Hispanist Jules Piccus, auf der Suche nach spanischen Heldenliedern, soll die Bände 1965 auf den Tisch bekommen haben, als er auf Verdacht zwei Leernummern des Katalogs bestellt hatte. Das ist eine oft wiederholte Legende. Eher glaubhaft erscheint, dass die Leitung der Bibliothek, motiviert durch wiederholte Nachfragen von André Corbeau und anderen Forschern, die Bände suchen ließ und sie schließlich auch fand: im Regal um einhundert Nummern verstellt3.
Für die Forschung waren die Bände Madrid I und II über 130 Jahre lang unzugänglich, ihr genauer Inhalt unbekannt. Ihre erneute Entdeckung fand deshalb ein beachtliches internationales Echo. Die New York Times berichtete Anfang 1967 ausführlich, in Spanien die führende Tageszeitung ABC und in Deutschland auch der Spiegel. Schnell stellte sich heraus, dass vor allem der stärkere der beiden Bände, der so genannte Codex Madrid I, für die Geschichte der Mechanik und die Stellung Leonardos in ihr von außerordentlicher Bedeutung sein würde. Den Auftrag zur Veröffentlichung erhielt der italo-amerikanische Ingenieur und Technikhistoriker Ladislao Reti, einer der erfahrensten Kenner spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Mechaniktraktate. Der 1901 in Fiume (Veneto) geborene Forscher, ausgebildet zum Chemieingenieur, war seit den 1950er Jahren mit grundlegenden Arbeiten über Schriften der Renaissance-Ingenieure hervorgetreten und so für die Veröffentlichung der neu aufgefundenen Handschriften in Madrid der ideale Bearbeiter4.
Noch im Mai 1966 anlässlich einer Tagung in Los Angeles hatte Reti, wie es scheint, keine sichere Kenntnis von der Wiederentdeckung in Madrid und sprach, angeregt durch den schon erwähnten André Corbeau, nur von bisher vergeblicher, aber eventuell aussichtsreicher Suche5. Anfang 1967 benachrichtigte ihn (nach Angabe von Ben Dibner) die Spanische Nationalbibliothek. Nun gingen die Dinge schnell voran. Reti nahm umgehend ein Flugzeug nach Madrid, überzeugte sich von der Authentizität der Handschriften und unterrichtete schon im Februar die amerikanische Presse, die ausführlich berichtete. Bereits Anfang Juli 1967 folgte auf Einladung des Leonardo-Kenners Ludwig Heydenreich ein wissenschaftlicher Vortrag Retis im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Die englische und deutsche Fassung dieses Vortrags erschien noch im gleichen Jahr6.
Zu beiden Codices Madrid lieferte dieser Beitrag Retis bereits gründliche und eindringende Einzelangaben. Herkunft und Datierung der Handschriften sind in ihm weitgehend vorgeklärt; Abbildungen aus dem ersten Band zeigen besonders bemerkenswerte Maschinenelemente wie Schraubenwinde, Rollen- und Kugellager, den Einsatz von Antikfriktionsmetall, Zahnradgetriebe mit epizykloidalen Zähnen, aber auch (ruhig laufende) Riemenantriebe, eine Vorform der Pelton-Turbine, Studien zu Zahnrädern und Kettentrieben, die Regulierung einer Kreisbewegung durch schwere Pendel und anderes mehr. Ein wesentliches Problem hat Reti gleich am Anfang herausgestellt: Wir wissen noch nicht, ob Codex I das Buch über die Maschinenelemente ist, auf das sich Leonardo an anderen Stellen bezieht
7.
2. Retis Facsimile-Edition von 1974
Retis Arbeit an der überaus schwierigen Transkription und Übersetzung der beiden Madrider Handschriften füllte die Jahre bis zu seinem Tode im Oktober 1973. Seit 1972 fand der Ingenieur Unterstützung durch Augusto Marinoni, Italiens besten Kenner der speziellen Paläographie und Philologie Leonardos8. In vorbereitenden Studien untersuchte Reti unter anderem die neu entdeckte Bücherliste von Leonardos Bibliothek und besprach das in älteren Ingenieurhandschriften kaum vertretene Material über Wellenlager, Getriebe und die Probleme der Reibung9. Dazu fand er überraschende Übereinstimmungen in dem bekannten Maschinenbuch des lombardischen Ingenieurs Augusto Ramelli (1588), dessen Quellen man bis dahin kaum kannte10. Inhaltliche Abgleichungen mit anderen Handschriften Leonardos ergaben wichtige Ergänzungen11.
Nur die wichtigsten Ergebnisse dieser vergleichenden Untersuchungen zu den beiden Handschriften Madrid I und II fanden Aufnahme in die 1974 erschienene fünfbändige Facsimileausgabe. Die Beschreibung der beiden Handschriften ist im dritten Band relativ kurz geraten, vermutlich wegen Retis frühem Tod schon im Herbst 1973. Einzelne Erläuterungen zur Mechanik sind nicht enthalten, auch keine genauere Inhaltsübersicht, wohl aber ein nützliches, wenn auch unvollständiges Wortregister (S. 127-148) und eine Auflistung der inhaltlichen Bezüge zwischen Madrid I und anderen Handschriften Leonardos, die der Benutzer berücksichtigen muss (Bd. 3 Anhang A).
Die Edition selbst enthält weder Überschriften noch sonstige Erklärungen. Auch sind die Bezüge zwischen den Texttranskriptionen von Madrid I (im Band 4 von Retis Edition) und den jeweils zugehörigen Zeichnungen im Band 1 oft nicht leicht herzustellen. Ausdrücklich erklärte Marinoni: Es fehlen leider die Register und die Beschreibungen der Zeichnungen, die Herr Ladislao Reti noch erstellen wollte
12.
3. Struktur der Madrider Handschrift: Praktischer und theoretischer Teil
Reti erkannte im Aufbau der Handschrift Madrid I sehr schnell einen grundsätzlichen Gegensatz: Die 95 ersten Blätter behandeln vornehmlich Objekte der mechanischen Praxis, die heute daran anschließenden 95 Blätter vornehmlich Theorie. Während nun aber der praktische Teil der Handschrift Madrid I bereits vielfältiges Interesse auf sich gezogen hat, ist der theoretische Teil noch weitgehend unerforscht. Mit ihm hat es auch buchtechnisch eine besondere Bewandtnis. Er bildete nämlich zunächst ein eigenes Volumen mit einer im Verhältnis zum ersten Teil genau umgekehrten Blattfolge.
Der überwiegend theoretische Teil beginnt im heutigen Codex am Ende, der überwiegend praktische Teil am Anfang. Für beide Teile präparierte Leonardo jeweils 6 Lagen mit 8 Doppelblättern, zusammengenäht jeweils 96 Blätter. Das jeweils erste Blatt blieb als Titelblatt zunächst leer. Nach Corbeau und Marinoni entspricht die Blattzahl der Lagen dem Normfall bei Leonardos Arbeitsmanuskripten13. Möglicherweise war es die Absicht des Autors, die jeweils 6 Lagen, in zwei Stapeln nebeneinander liegend, gleichzeitig bearbeiten zu können. Der theoretische Teil sollte nach einer isoliert wirkenden Aussage Leonardos den Anfang bilden, der praktische folgen. Dies gilt aber nur, wenn wir seiner Aussage vertrauen, die Theorie habe voranzugehen, was vom Zusammenhang seines einzigen Zitats zu dieser Frage nicht zwingend erscheint14.
Sicher ist: Der theoretische Teil trägt so, wie der Codex sich heute präsentiert, eine von hinten nach vorn laufende Zählung der Folien von 1 bis 95 in Leonardos charakteristischer Spiegelschrift. Diese ursprüngliche Zählung findet sich jeweils auf der Verso-Seite der modernen Zählung, die erst später ab fol. 95 des ersten Teils weiter geführt wurde. Die ursprüngliche Abfolge des theoretischen Teils macht jedoch auch inhaltlich Sinn. Es geht vom Einfachen zum Komplizierteren, vom Grundsätzlichen zum Konkreteren. In Leonardos theoretischen Ausführungen zu Statik und Dynamik finden sich darüber hinaus die meisten Bezüge zu seinen früheren Handschriften.
Zeichnerisch wirkt der theoretische Teil weniger ansehnlich als der von der Praxis bestimmte Teil. Wir belassen die Praxis deshalb an der Spitze der Edition. Es ist besser, mit Leonardos ansehnlicher Studie zur Kurbelwelle zu beginnen, die im ganzen 15. Jahrhundert ein außerordentliches Interesse bei fast allen technischen Autoren hervorrief, als mit der wenig ansehnlichen, extrem überladenen ersten Seite des theoretischen Teils, die nur Text bietet.
Der praktische Teil, das heißt die (heute) erste Hälfte des Bandes, beeindruckt dagegen sofort durch die außerordentliche Sorgfalt und Plastizität der meisten ihrer Zeichnungen. Es sind Apparaturen, die einzeln mit ausführlicher Erläuterung eine ganze Seite füllen können (fol 1r, 4r, 14v, 15r, 16r, 30r usw). Oft bietet eine Seite aber auch mehrere unterschiedliche, zuweilen völlig heterogene Mechanismen. Dazu kommen nachgetragene Einzelstudien wie etwa auf fol. 5v der Abschnitt zum Ineinandergreifen der Zahnräder, ein Thema, das stärker theoretisch auf fol. 118r-120r behandelt wird.
Vornehmlich handelt es sich im ersten Teil also um Beobachtungen aus der Praxis, so auch bei den Ketten (fol. 10r), den Getrieben (passim), der Uhrentechnik (fol. 12r, fol. 27v und öfter), der Schlosserei (fol. 47v-50r, 98v-99v), den Schusswaffen und Poliermaschinen für Brennspiegel(fol. 59r- 61r), den Textilmaschinen (fol. 65v-68v), den Messinstrumenten im Tunnelbau (Teil 2 fol. 80v - 81r) usw. Vieles davon scheint Leonardo in Mailand und dessen Umgebung selbst gesehen zu haben, er will es verbessern15.
Das Material zur praktischen Mechanik hat jedoch einen solchen Umfang angenommen, dass es bald auf Blätter des zweiten Teiles ausuferte und dort rückläufig von fol. 95v bis mindestens fol. 67r (Reti fol. 124v) vordrang. Andererseits erscheinen theoretische Ausführungen zu Statik und Gewichten irrtümlich auch schon im ersten Teil, so auf fol. 71r bis 79r. Die Richtung von Leonardos Eintragungen scheint auch innerhalb der beiden Teile gelegentlich zu wechseln16. Leonardo war offensichtlich ein sehr kreativer, aber auch zerstreuter Autor.
Zählung der Skizzen: Ergänzend zur rückläufigen
Foliozählung zeigt auch die Zählung der meist kleinen Skizzen im theoretischen Teil aus heutiger Sicht eine rückwärts schreitende Richtung. Diese am heutigen Ende der Handschrift einsetzende Skizzenzählung läuft auf den Blättern 1r bis 19v (ursprüngliche Zählung) von Nr. 1 bis Nr. 100. Sie erfasst längst nicht alle Skizzen (manche sind nachgetragen) und wechselt auf den einzelnen Seiten teilweise in der Richtung von oben nach unten, von unten nach oben bzw. von links nach rechts und rechts nach links. Eine zweite Skizzenzählung beginnt auf derselben Seite 19v erneut mit 1, 2 und läuft mit Unterbrechungen bis 90 auf fol. 33v (158r). Gemeint sind hier wohl die Zahlen 101 bis 190. Der Sinn dieser Zählungen hängt möglicherweise zusammen mit der geplanten Übernahme der Skizzen in ein weiteres Werk Leonardos zur Mechanik (Elementi macchinali ?).
Eine Zählung der Lagen durch Leonardo ist nicht erhalten. Die vorhandene Zählung könnte aus dem späteren 16. Jahrhundert stammen. Sie zieht sich durch den gesamten Band (ein Indiz, dass die beiden Lagenstapel inzwischen vereint worden sind) und geht erneut von hinten nach vorn (fol. 176r Lage 1, fol. 0r Lage 12). Kein Zusammenhang besteht (trotz einer zufälligen Übereinstimmung) zwischen dieser Lagenzählung und den zahlreichen internen Verweisen Leonardos, die Johnston (2000) auf Lagen und Blätter des Codex Madrid I beziehen wollte17. Reti kannte die alte Markierung, zählte die Lagen aber trotzdem im heutigen Sinn von vorn nach hinten. Insgesamt konnte er sich vor seinem Tode nicht mehr dazu durchringen, seine Edition entsprechend den Angaben des Autors im zweiten Teil von hinten
anfangen zu lassen18.
Die neue Edition soll zeigen, dass die ursprüngliche Anordnung für das Verständnis von Leonardos Konzeption der mechanischen Theorie unerlässlich ist. Die Internet-Edition wird somit die ursprüngliche Abfolge der Blätter im zweiten Teil wiederherstellen, den praktischen Teil aber an der Spitze belassen.
4. Von Venturi zu Mario Taddei: Ältere und neuere Studien zur Mechanik Leonardos
Die Rezeption von Leonardos Studien zur Mechanik beginnt angeblich bereits im 16. Jahrhundert mit Cardano, Ramelli, Baldi und vielleicht auch Guidobaldo del Monte (1577-1581). Die Klärung dieser Verbindungen ist jedoch keineswegs abgeschlossen. Die moderne Beschäftigung mit Leonardos naturwissenschaftlich-technischen Interessen setzt deshalb erst 1793 ein. In diesem Jahr veröffentlichte Gian Battista Venturi seinen berühmten Vortrag vor der französischen Académie 1793: Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci. Der bekannte Physiker Venturi besprach darin vor allem seine Lesefrüchte aus Leonardos zwölf kurz zuvor nach Paris verbrachten Skizzenbüchern, die bis heute in der Bibliothek des Pariser Institut de France aufbewahrt werden.
Anschließend an Venturi und andere italienische Autoren plädierte 1874 Hermann Grothe als erster in Deutschland für einen Neuansatz der Physikgeschichte, insbesondere der Mechanik, schon durch Leonardo und nicht erst durch Galilei. In Italien folgten in den 1930er Jahren Arbeiten von Roberto Marcolongo und, 1940, der umfangreiche Versuch einer Rekonstruktion
von Leonardos damals bekannten Schriften zur Mechanik durch Arturo Uccelli. Genau genommen rekonstruierte Uccelli nicht verlorene Werke, sondern sammelte Fragmente geplanter Schriften, die zumeist weit vor der Vollendung geblieben waren. Er ordnete sie unter sachlichen Gesichtspunkten, die Leonardo zum Teil bereits genannt hatte. Sein Verfahren nannte er logisch-inhaltlich im Gegensatz zur älteren historisch-chronologischen Methode, die stärker auf die relative Chronologie der Handschriften abgehoben hätte19.
Eine völlig neue Lage ergab sich mit der Wiederauffindung und ersten Publikation des Codex Madrid I in den Jahren 1965-1974. Die Studien des Herausgebers Ladislao Reti haben wir bereits erwähnt. Am wichtigsten war seine Ansicht, dass Leonardo die moderne Lehre von den Maschinenelementen und ihren Bewegungsmechanismen bereits vorweggenommen habe; man hatte sie zuvor viel später angenommen, nämlich erst am Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich und danach bei Franz Reuleaux. Fast alle 22 Maschinenelemente, die 1875 in der klassischen Kinematik von Franz Reuleaux aufgelistet sind, finden sich in der Tat, wenn auch zerstreut und in anderer Reihenfolge, schon etwa 380 Jahre früher im Codex Madrid I.
Den wichtigsten Beitrag zum Vergleich mit der modernen Mechanik lieferte 1982 der österreichische Philosoph und Wissenschaftshistoriker Herbert Maschat. Seine Arbeit über Leonardo da Vinci und die Technik der Renaissance entspricht tatsächlich eher einer Ausdeutung der Mechanik Leonardos im Licht der modernen Maschinenlehre. Regelmäßig bietet er Umsetzungen in die Sprache der modernen Lehrbücher wie derer von Ewald Strathausen zu den Hebemaschinen (1960) oder Roloff/Matek, Maschinenelemente (1974) bzw. Tochtermann/Bodenstein, Konstruktionselemente (1979). Diese Darlegungen enthalten für technisch gebildete Leser einen hohen Erkenntniswert. Trotzdem befreien sie nicht von der Mühe, sich in Leonardos Arbeitsweise einzudenken und zu erforschen, was er vorfand und in welcher Weise er es bearbeitet hat.
In ähnlicher Weise wie Maschat zielt auch der amerikanische Mechanikprofessor Francis C. Moon 2007 vornehmlich auf die Bezüge zwischen Leonardos neu entdeckter Handschrift und der Wissenschaft von den Maschinen im 19.-20 Jahrhundert. Sein Titel lautet: The Machines of Leonardo da Vinci and Franz Reuleaux
, der Untertitel: Kinematics of Machines from the Renaissance to the 20th Century
. Eine seiner wichtigsten Schlussfolgerungen für unsere Zwecke formuliert er so (S. 71):
There is no evidence that the work of Leonardo da Vinci had any influence on the concept of the kinematic chain even if the principal kinematic theorists such as Monge, Willis or Reuleaux had complete access to the Notebooks of Leonardo. Leonardo's work does show a shift in the 15th century to an interest in motions in machines as contrasted with forces. And he deserves credit for recognizing the existence of basic machine elements in the synthesis of machines. Thus Leonardo's drawings of machine components often show combinations of kinematic pairs, such as gear teeth in contact or elements of chains. This idea evolved into the later drawings of Leupold (1724) that many theorists such as Willis and Reuleaux had used for reference. But it was Reuleaux and his contemporaries in the 19th century that formalized the idea that mechanisms are essentially described by a circuit of geometric constraints.
Zuletzt erschien 2007 in Mailand (2008 auch in München) das beeindruckende Werk von Mario Taddei, Leonardo dreidimensional 2: Neue Roboter und Maschinen. Hier steht im Mittelpunkt die Rekonstruktion konkreter Maschinen Leonardos mit den Mitteln digitaler Zeichenprogramme. Ein vorangestelltes Kapitel über Einfache und Komplexe Maschinenelemente widmet sich den einschlägigen Materialien des Codex Madrid I. Leonardo erscheint einerseits als Vorläufer moderner Maschinen wie beispielsweise der Textilmaschinen von Vaucanson und Galle (18. Jahrhundert), andererseits aber auch als Beobachter älterer, im 15. Jahrhundert schon bekannter Apparaturen wie der Uhrhemmung einschließlich ihrer damals neuesten Ausprägung in Form von Getrieben mit Federaufzug.